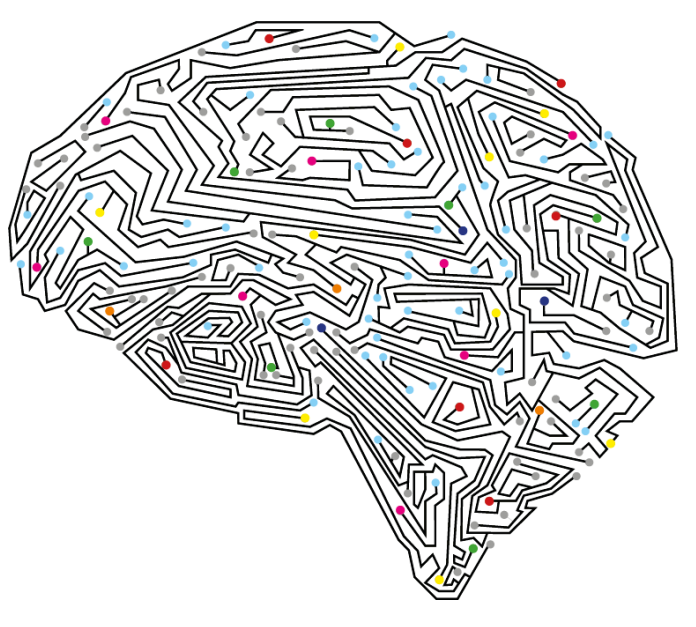Humanismus im 21. Jahrhundert
Die Würde der Anderen

Auf der Suche nach einem zukunftstauglichen Humanismus für das 21. Jahrhundert ist eine der wegweisenden Kreuzungen, die es zu passieren gilt, jene der kulturellen Differenzen und intersektional unerschöpften Potentiale im Globalisierungsprozess. In Weiterführung der Gedanken des fellows Robin, welcher von der Notwendigkeit spricht „neue Gedankenpaläste der Menschlichkeit zu errichten, in deren Hallen wir die Grundzüge einer universalen Ethik für das digitale Zeitalter konzipieren können“, ist mein Postulat, dass die Einigung der Kulturen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner von „einer Menschlichkeit“, wie sie als Fundament in der Menschenrechtscharta 1948 festgehalten wurde, den Grundstein jeder weiterführenden Existenz des Humanismus bildet, gerade im digitalen Zeitalter.
Die Basis des Humanismus sind Maximen der Menschenwürde und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit bzw. Selbstbestimmung, sowie Frieden und Gleichberechtigung der Geschlechter. Hinzu kommen Normen wie eine wissenschaftliche Welterklärung, Solidarität und Toleranz. Konzeptuell können diese Werte allerdings nur Stand halten, wenn sie vor ihrer gesellschaftserwachsenen Wahrheit zwischen globalem Norden und Süden gesehen werden: einer einseitig westlichen, Weißen [1], heteronormativen und cis-sexuellen Perspektive der humanen Realität.
Es wäre ein Leichtes zu behaupten, dass der Status quo als Konsequenz historischer Entwicklungen dem Verantwortungsbereich unserer Generation entwachsen sei. Ein Beispiel hierfür wäre die Kolonialisierung durch den globalen Norden – welche den Geschichtsverlauf und die Identitätsverwurzelung ganzer Kulturen des globalen Südens unwiderruflich und unentschuldbar verdrängte –, und die daraus folgende „Exotisierung“ fremder Völker – die fremdverzerrte, romantisierte und degradierende Darstellung aus westlicher Perspektive, welche als Faktum in die Geschichtsschreibung Einzug fand [2]. Neben wirtschaftlichen Faktoren sind es v.a. diese vermeintlichen Artefakte einer anderen Zeit, welche im 21. Jahrhundert soziale Unterschiede gebieten werden. Die westliche Kultur setzt noch immer den Maßstab, an dem sich der Rest der Welt orientiert, denn die uralten Geschichten der Eroberung, Plünderung und mutmaßlichen Zivilisierung durch „den weißen Mann“ hallen immer noch nach. Sei es, dass die Metropolen der Welt alle dieselbe US-amerikanische Popmusik abspielen, weil diese als „sophisticated“ gegenüber lokalen und teilweise nur mündlich überlieferten Gesängen betrachtet wird (ganz gleich der lyrisch-inhaltlichen Banalität ersterer); oder dass weiße Haut und helle Haare international als Schönheitsideal gelten. Dies geht sogar so weit, dass in vielen Teilen Ostasiens selbst im 21. Jahrhundert sogenannte „weißmachende“ Schönheitscremes immer noch und immer mehr zur Hygieneroutine gehören, denn weiße Haut wird mit Reichtum assoziiert und deswegen als Möglichkeit zur Wertsteigerung auf dem Heiratsmarkt erachtet. Weniger offensichtlich, doch umso bedeutsamer ist der Umstand, dass die vermutlich größte institutionelle Errungenschaft der Völkerverständigung des 20. Jahrhunderts, die Vereinten Nationen, seit über 70 Jahren unverändert nach europäisch-amerikanischem Managementmodell operieren.
Dabei kann das westliche Bild der Welt diese in all ihren Facetten gar nicht erfassen oder abbilden, wie die Ergebnisse postkolonialer Forschung eindrücklich zeigen. Außerdem laufen die Vereinten Nationen so Gefahr, ihrem Ideal nicht gerecht zu werden: Um dem Mosaik von „einer Menschlichkeit“ wirklich zu entsprechen, ist es notwendig, die Vielfältigkeit menschlichen Seins ausgewogen zu repräsentieren. Deshalb gewinnt das Konzept der Intersektionalität stetig an Relevanz. Es umfasst die additiven wie auch exklusiven (d.h. sich in einer Person überschneidenden oder singulär auftretenden) Diskriminierungsformen von Rasse, Nationalität, sexueller Orientierung, Genderidentität und Behinderung – quasi alle von der einheitlich kaukasischen, westlichen, heteronormativen, cis-sexuellen und unbeeinträchtigten Perspektive der humanen Realität abweichenden Merkmale, welche in ihrem Zusammenspiel den konstituierenden Effekt von Macht- oder Ohnmacht-Stellung in der Gesellschaft ausmachen; eine Realität, welche durch die vielen Generationen von unangefochtener Geschichtsschreibung ihre vermeintliche Legitimität in Stein gemeißelt zu haben scheint. Intersektionalität ist nicht nur eine der wichtigsten Maximen im zeitgenössischen Feminismus, sondern vor allem eine nach innen gerichtete Handlungsanweisung, welche darauf abzielt, sich der eigenen Privilegien zu vergegenwärtigen und aus diesem Bewusstsein heraus die Diskriminierung und Unterdrückung anderer wahrzunehmen, ohne sich anzumaßen, für diese sprechen zu können. Eine gelebte intersektionale Gesellschaftspolitik kann das Menschsein revolutionieren, indem die eine allumfassende Menschlichkeit zum ersten Mal in den Vordergrund rückt. Denn nach wie vor herrscht ein eklatantes Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Zusammensetzung unserer Gesellschaft und den im öffentlichen Diskurs präsenten Bevölkerungsgruppen. Millionen von Menschen sehen also ihresgleichen kaum oder gar nicht in der öffentlichen Gesellschaft, wie sie durch Medien, Politik, Wirtschaft und Kultur dargestellt wird, repräsentiert.
Nur langsam findet hier ein allmählicher Wandel statt: 2018 produziert Hollywood mit „Black Panther“ und „Crazy Rich Asians“ die ersten beiden Filme dieser Größenordnung überhaupt, welche afrikanische Held*innen bzw. asiatische Protagonist*innen in den viel zu lange erkämpften Mainstream führt; Star-Models wie Winnie Harlow mit Vitiligo-Krankheit oder Dragqueen Conchita Wurst sind von den Bühnen nicht mehr wegzudenken; und basispolitisch sind es aktuell die Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, welche die fundamentale oppositionelle Funktion eines Herausforderns des politischen Establishments durch die #metoo- bzw. #metwo-Bewegungen ausführen. Gleichzeitig erleben wir in Europa und den USA aktuell eine immer mehr in die Mitte der Gesellschaft wandernde Identitätssuche konservativer, Weißer Bevölkerungsgruppen, die von der Angst um den Verlust des eigenen Status getrieben zu sein scheint und Nährboden für nationalistische und rechtsextreme Bewegungen bietet. Hier gilt es anzusetzen und zu vermitteln.
Wir können einen zukunftstauglichen Humanismus nur ausbilden, wenn wir die Würde der Menschen in ihrer gesamten kulturellen und intersektionalen Differenz wie auch ihrem Potential erfassen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist eine ausgewogene öffentliche Repräsentation dieser Vielfältigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Fellow Victoria schreibt zur Würde folgende Zeilen: „Anders als Ehre und Ruhm, die einen durch die Gesellschaft zugeschriebenen äußeren Wert darstellen, kommt die Würde von Innen. Sie ist das Bewusstsein des eigenen Wertes und eine daraus resultierende Haltung, die in einen Gestaltungsauftrag mündet, wenn wir uns z.B. entschließen, unerträgliche Zustände nicht weiter hinzunehmen, sondern zu verändern, im äußersten Falle durch Rebellion.“ Hiervon sind nicht nur die Stärke, geistige Unabhängigkeit und der Optimismus, welche Victoria hier in Charlie Chaplins Figur des tramp als Ausdruck einer humanistischen Lebensphilosophie liest, abzuleiten, sondern gleichermaßen der allen Menschen und Kulturen inhärente Drang zur geistig unabhängigen Gestaltung. In einem zeitgemäßen Humanismus für das 21. Jahrhundert wird es essentieller Teil unserer Verantwortung als Menschen und Bürger*innen einer globalen Welt sein, diese uneingeschränkt allen zu ermöglichen. Nur dann werden wir unseren eigenen, in der Menschenrechtscharta formulierten, Idealen gerecht. Nur dann könnte das 21. Jahrhundert eines der spannendsten und inspirierendsten Momenta der menschlichen Co-Existenz bisher werden.
[1] Anm. der Autorin : “Weiß” und “Weißsein“ bezeichnen ebenso wie “Schwarzsein“ keine biologische Eigenschaft und keine reelle Hautfarbe, sondern eine politische und soziale Konstruktion. Mit Weißsein ist die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst zumeist unausgesprochen und unbenannt bleibt. Weißsein umfasst ein unbewusstes Selbst- und Identitätskonzept, das weiße Menschen in ihrer Selbstsicht und ihrem Verhalten prägt und sie an einen privilegierten Platz in der Gesellschaft verweist, was z.B. den Zugang zu Ressourcen betrifft. Eine kritische Reflexion von Weißsein besteht in der Umkehrung der Blickrichtung auf diejenigen Strukturen und Subjekte, die Rassismus verursachen und davon profitieren, und etablierte sich in den 1980er Jahren als Paradigmenwechsel in der englischsprachigen Rassismusforschung. Anstoß hierfür waren die politischen Kämpfe und die Kritik von People of Color. […] Um das deutlich zu machen, wird dafür plädiert die Zuschreibungen Schwarz und Weiß groß zu schreiben. (Quelle: Amnesty International, 2017, Glossar für diskriminierungssensible Sprache, https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache)
[2] Vgl. Edward Saids Konzept des Orientalismus als kulturelle Äußerung politischer Machtverhältnisse, deren Vorstellungen bis heute nachwirken